Was ist eine Einliegerwohnung - und warum lohnt sich die Vermietung?
Eine Einliegerwohnung ist keine einfache Nebenwohnung. Sie ist eine vollständig abgetrennte Wohneinheit innerhalb eines Zweifamilienhauses - mit eigenem Eingang, eigener Küche und eigenem Bad. Der Vermieter lebt in der anderen Wohnung. Das ist kein Nebeneffekt, sondern die Voraussetzung für die wichtigsten Rechte und Vorteile. Seit den 1950er Jahren wurden solche Wohnungen in Deutschland als Lösung gegen den Wohnungsnotstand gefördert. Heute sind sie ein beliebtes Modell für Eigenheimbesitzer, die neben dem eigenen Wohnraum eine zusätzliche Einkommensquelle schaffen wollen.
Im Jahr 2022 machten Einliegerwohnungen bereits 12,7 Prozent aller neu gebauten Wohnungen in Deutschland aus. Das ist kein Zufall. In Ballungsräumen wie Hamburg, Berlin oder München ist die Nachfrage hoch, die Mieten stabil, und die steuerlichen Vorteile attraktiv. Doch viele Vermieter unterschätzen die rechtlichen Fallstricke. Wer denkt, dass jede kleine Wohnung im Keller oder im Dachgeschoss als Einliegerwohnung gilt, liegt falsch. Nur wenn alle gesetzlichen Kriterien erfüllt sind, greift das Sonderkündigungsrecht - und damit der größte Vorteil.
Das Sonderkündigungsrecht: Ihr größter Vorteil - und seine Grenzen
Das Sonderkündigungsrecht nach § 573a BGB ist das Herzstück der Einliegerwohnung. Es erlaubt Ihnen, den Mieter ohne Angabe von Gründen zu kündigen - etwas, das bei normalen Mietverhältnissen fast unmöglich ist. Das ist kein Bonus, das ist eine Ausnahme. Und sie gilt nur unter strengen Bedingungen.
Erstens: Das Haus muss genau zwei Wohnungen haben. Zweitens: Sie selbst müssen in einer der beiden wohnen. Drittens: Die Wohnung muss einheitlich gebaut sein. Das bedeutet: Kein Reihenhaus, kein Bungalow, keine zwei getrennte Häuser mit Gangverbindung. Der Bundesgerichtshof hat das 2008 klar festgelegt. Ein Urteil des Oberlandesgerichts München vom Mai 2023 hat das noch verschärft: Der Eingang zur Einliegerwohnung darf nicht durch Ihren privaten Bereich führen. Kein Gang durch Ihre Küche, keine Tür durch Ihr Wohnzimmer. Der Mieter muss unabhängig und ohne Ihren Besitz zu betreten, in seine Wohnung gelangen.
Die Kündigungsfrist ist länger als bei normalen Mietverhältnissen: 6 Monate statt 3. Bei einer Mietdauer von mehr als 5 Jahren steigt sie auf 9 Monate, bei über 8 Jahren auf 12 Monate. Das klingt nach Nachteil - ist es aber nicht. Es gibt Ihnen Zeit, einen neuen Mieter zu finden, ohne dass der alte plötzlich raus muss. Der Nachteil? Wenn der Mieter schwer krank ist, behindert oder kurz vor der Rente steht, dürfen Sie nicht einfach kündigen. Die Gerichte prüfen dann, ob die Kündigung eine „besondere Härte“ bedeutet. Ein Mieter, der 68 ist und 20 Jahre in der Wohnung lebt? Dann wird das Gericht Ihnen die Kündigung verweigern.
Steuerliche Vorteile: Wie Sie Geld sparen, ohne zu investieren
Die Vermietung einer Einliegerwohnung ist nicht nur eine Einkommensquelle - sie ist eine Steuersparmaßnahme. Sie können fast alle Kosten absetzen, die mit der Wohnung zusammenhängen. Das ist kein Geheimtipp, das ist gesetzlich geregelt.
Die wichtigste Abschreibung ist die Absetzung für Abnutzung (AfA). Bei einem Neubau können Sie jährlich 2 Prozent der Herstellungskosten absetzen. Wenn Ihr Haus 300.000 Euro gekostet hat und die Einliegerwohnung die Hälfte der Fläche einnimmt, können Sie 3.000 Euro pro Jahr absetzen. Das ist kein Geld, das Sie ausgeben - das ist Geld, das Sie nicht versteuern müssen.
Dazu kommen: die anteiligen Zinsen Ihres Baudarlehens, Reparaturen, Instandhaltung, Heizkosten für die gemeinsamen Räume, sogar Gartenpflege, wenn der Mieter den Garten nutzt. Wenn Sie die Heizkosten nach Quadratmeter abrechnen, können Sie auch die Kosten für die Heizungsanlage absetzen - vorausgesetzt, alle Heizkörper haben Messeinrichtungen.
Wichtig: Wenn Sie die Wohnung an ein Familienmitglied vermieten, müssen Sie eine Mindestmiete verlangen. Sonst werden die Steuervorteile gestrichen. Die genaue Grenze ist umstritten: Einige Finanzämter verlangen 66 Prozent der ortsüblichen Miete, andere 75 Prozent. Der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Wohnen vom Oktober 2023 plant, diese Grenze auf 75 Prozent anzuheben - und das ab 2024. Wer jetzt noch 60 Prozent Miete verlangt, riskiert eine Nachzahlung. Berechnen Sie also immer mit dem höheren Wert.

Der Mietvertrag: Was unbedingt stehen muss - und was Sie vermeiden sollten
Ein Mietvertrag für eine Einliegerwohnung ist kein Standardformular. Er muss genau beschreiben, was gemeinsam genutzt wird und was nicht. Viele Streitigkeiten entstehen, weil das nicht klar geregelt ist.
Erster Punkt: Möbliert oder unmöbliert? Wenn Sie die Wohnung unmöbliert vermieten, fallen viele Mieterschutzregeln weg - etwa die strengen Vorschriften zur Mieterhöhung. Das ist ein Vorteil. Aber: Sie dürfen keine Möbel stellen, die der Mieter später „mitnutzt“. Sonst gilt die Wohnung als möbliert - und Sie verlieren die Vorteile.
Zweiter Punkt: Gemeinschaftliche Räume. Wer nutzt den Keller? Wer zahlt für die Waschmaschine? Wenn Sie die Waschmaschine im Keller aufstellen und sie dem Mieter zur Verfügung stellen, müssen Sie sie auch reparieren oder ersetzen. Wenn Sie sie nur als „gemeinsame Einrichtung“ bezeichnen, ohne sie explizit zu vermieten, können Sie den Mieter zur Wartung verpflichten. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Dritter Punkt: Der Garten. Wer pflegt ihn? Wer darf Blumen pflanzen? Wer darf Bäume fällen? Das muss im Vertrag stehen. Eine Umfrage des Deutschen Mieterbundes aus 2023 zeigt: 28,3 Prozent der Vermieter hatten Konflikte wegen des Gartens. Ein klarer Vertrag verhindert das.
Viertes und entscheidendes Element: Die Heizkostenabrechnung. Sie haben zwei Möglichkeiten: entweder nach Verbrauch (mit Messgeräten) oder nach Quadratmetern. Wenn Sie nach Verbrauch abrechnen, müssen alle Heizkörper mit Ventilen und Zählern ausgestattet sein. Das kostet Geld - aber es ist die einzige Methode, die Sie auch steuerlich voll absetzen können. Wenn Sie nach Quadratmetern abrechnen, ist es einfacher - aber Sie können nur einen Teil der Kosten absetzen.
Wirtschaftlichkeit: Wo es sich lohnt - und wo nicht
Die Rendite einer Einliegerwohnung ist nicht überall gleich. In Hamburg, Frankfurt oder München liegt sie durchschnittlich bei 3,8 Prozent vor Steuern. In ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern oder dem Erzgebirge sinkt sie auf 2,1 Prozent - und manchmal sogar auf null.
Warum? Weil die Mieten niedrig sind, aber die Sanierungskosten hoch. Ein Haus aus den 1960er Jahren in einer Kleinstadt braucht eine neue Heizung, neue Fenster, neue Dämmung - und das kostet 80.000 bis 120.000 Euro. Wenn die Miete nur 500 Euro pro Monat beträgt, brauchen Sie 15 Jahre, um die Investition zu amortisieren. Und das ohne Zinsen, ohne Instandhaltung, ohne Leerstand.
Die Kaltmiete für Einliegerwohnungen lag im dritten Quartal 2023 bei 11,20 Euro pro Quadratmeter. Das ist 15 Prozent unter dem Durchschnitt für neue Neubauwohnungen, aber 8,7 Prozent über dem für Bestandswohnungen. Das heißt: Sie können nicht so viel verlangen wie ein Neubau, aber mehr als eine alte Wohnung. In Hamburg liegt die durchschnittliche Kaltmiete für eine 50-Quadratmeter-Einliegerwohnung bei 650 Euro. In Lübeck sind es 480 Euro. Der Unterschied ist riesig.
Die Erfahrungen von Vermietern sind gemischt. 68 Prozent berichten von positiven Erfahrungen - vor allem wegen der einfachen Kündigung und der guten Nachbarschaft. Aber 42,7 Prozent hatten Probleme mit der Heizkostenabrechnung, und 28,3 Prozent mit dem Garten. Ein Nutzer auf Reddit schreibt: „Seit drei Jahren vermiete ich an eine Studentin. Die Steuervorteile bringen mir 1.200 Euro pro Jahr.“ Ein anderer: „Nach 18 Monaten musste ich kündigen - die 6-Monats-Frist hat mich 4.500 Euro an Miete gekostet.“
Die Schlussfolgerung: Es lohnt sich nur, wenn Sie in einer Stadt mit hohen Mieten leben, Ihr Haus nicht sanierungsbedürftig ist, und Sie den Vertrag richtig aufsetzen. In ländlichen Gegenden ist es oft eine finanzielle Belastung - kein Investment.

Was kommt als Nächstes? Die Zukunft der Einliegerwohnungen
Die Nachfrage nach Einliegerwohnungen steigt - nicht nur wegen der Rendite, sondern wegen der Gesellschaft. Die Bevölkerung altert. Viele Eltern wollen nahe bei ihren Kindern wohnen, aber nicht unter einem Dach. Die Einliegerwohnung ist die perfekte Lösung: Nähe ohne Verdrängung.
Das Deutsche Institut für Urbanistik prognostiziert bis 2030 ein jährliches Wachstum von 5,2 Prozent. Das bedeutet: Mehr Bauvorhaben, mehr Nachfrage, mehr Wettbewerb. Aber auch mehr Regeln. Die Bundesregierung plant, die Mindestmiete für Verwandte auf 75 Prozent anzuheben. Das wird Steuergestaltungen erschweren - aber auch die Rentabilität für viele Familien reduzieren.
Prof. Dr. Klaus Goldammer von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin warnt: „Die wirtschaftliche Rentabilität ist stark ortsabhängig. In vielen ländlichen Regionen ist die Einliegerwohnung kein Gewinn, sondern eine Belastung.“ Seine Studie an 150 Kommunen zeigt: In 37 Prozent der Fälle war die Rendite negativ, wenn man alle Kosten einrechnete - einschließlich Leerstand und Instandhaltung.
Die Zukunft gehört den klugen Vermietern: Wer den Vertrag richtig schreibt, die Steuern richtig nutzt und in der richtigen Stadt lebt, profitiert. Wer es als einfache Nebeneinkunft sieht, riskiert Ärger, Kosten und Enttäuschung.
Checkliste: 5 Dinge, die Sie jetzt prüfen müssen
- 1. Ist Ihr Haus wirklich ein Zweifamilienhaus? Nur zwei Wohnungen, eine davon bewohnt von Ihnen. Keine Reihenhäuser, keine Bungalows.
- 2. Hat die Einliegerwohnung einen eigenen Eingang? Und führt er nicht durch Ihren Wohnbereich? Sonst verlieren Sie das Sonderkündigungsrecht.
- 3. Haben Sie die Mindestmiete erreicht? Rechnen Sie mit 75 Prozent der ortsüblichen Kaltmiete - besonders bei Verwandten.
- 4. Ist der Mietvertrag richtig formuliert? Klären Sie: Möblierung, Garten, Heizkosten, gemeinsame Räume. Alles schriftlich.
- 5. Haben Sie die Steuervorteile berechnet? AfA, Zinsen, Reparaturen - alles absetzbar. Aber nur, wenn Sie die Buchhaltung ordentlich führen.
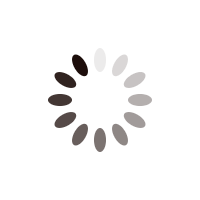









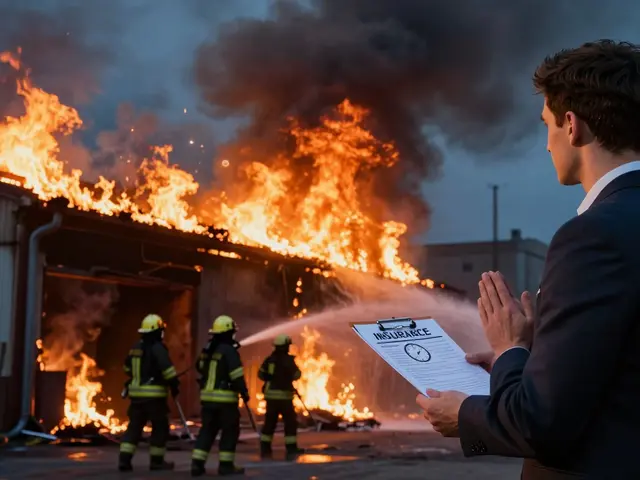

Kommentare (15)
Nadja Senoucci
November 8, 2025 AT 00:52Einliegerwohnung? Nur wenn der Eingang nicht durch meine Küche führt. Punkt.
Nadine Jocaitis
November 9, 2025 AT 14:25Ich vermiete seit fünf Jahren eine Einliegerwohnung und kann nur sagen: Die Kündigungsfrist von sechs Monaten hat mich vor einem echten Desaster bewahrt. Der Mieter war krank, aber ich hatte Zeit, alles zu regeln. Kein Stress, kein Drama.
David Kavanagh
November 10, 2025 AT 09:02Wichtig ist, dass ihr die Heizkostenabrechnung richtig macht. Viele vergessen, dass nur mit Messgeräten alles absetzbar ist. Ich hab vor zwei Jahren 1.200 Euro nachzahlen müssen, weil ich nach Quadratmetern abgerechnet hatte. Kein Spaß, wenn das Finanzamt zuschlägt.
Karoline nuñez
November 11, 2025 AT 18:48Weiß jemand, ob das mit der 75%-Mindestmiete für Verwandte wirklich nur ein Trick von der Regierung ist, um uns alle zu kontrollieren? Ich schwöre, sie wollen uns dazu zwingen, unsere Kinder rauszuwerfen. Das ist kein Wohnen mehr, das ist soziale Entmündigung...
Britt Luyckx
November 12, 2025 AT 10:07Ich hab letztes Jahr eine Einliegerwohnung in Köln vermietet, und es war ein Traum! Der Mieter ist ein netter älterer Herr, der mir Blumen aus dem Garten mitbringt. Die Steuervorteile sind echt krass – und die Nachbarschaft? Perfekt. Einfach nur gut gemacht!
Jan Philip Bernius
November 12, 2025 AT 11:05Garten im Vertrag regeln? Warum nicht einfach sagen wer was macht und fertig
Gretel Hans
November 13, 2025 AT 11:06Es ist unerlässlich, den Mietvertrag gemäß § 573a BGB und den geltenden Mietrechtsgesetzen exakt zu formulieren. Insbesondere hinsichtlich der gemeinschaftlich genutzten Flächen, der Heizkostenverteilung sowie der Definition von „möglicherweise mitgenutzten“ Möbeln. Jede Unklarheit kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.
Gary Hamm
November 14, 2025 AT 19:40Also, wenn man das alles so liest, fragt man sich: Warum baut man überhaupt noch Häuser? Die Regeln sind so kompliziert, dass man eigentlich nur noch ein Anwalt braucht, um eine Wohnung zu vermieten. Und dann sagt man noch, Deutschland sei ein Land der Freiheit. Ach ja, die Freiheit, 20 Seiten Vertrag zu unterschreiben.
Julia Hardenberger
November 15, 2025 AT 07:46Die ganze Diskussion über Einliegerwohnungen ist doch nur ein Symptom der kapitalistischen Entfremdung. Wir bauen nicht mehr für Menschen, sondern für Renditen. Wer will noch echte Nachbarschaft, wenn man jeden Monat einen Mieter abkassieren muss? Die Wände zwischen uns werden immer dicker – und die Steuervorteile immer wichtiger. Ist das Leben noch lebenswert?
Alex Byrne
November 16, 2025 AT 00:1275% Miete für Verwandte? LOL. Die Regierung will uns alle in die Armut treiben. Ich hab meiner Schwester 60% gegeben, und jetzt sagt das Finanzamt, ich soll nachzahlen? Ich hab doch keine 10k liegen! Und wer kontrolliert das überhaupt? Die haben doch keine Ahnung wie das Leben wirklich ist!
Maggie Knowles
November 17, 2025 AT 08:37So viele Regeln… 🤦♀️ ich vermiete seit 3 Jahren, hab nie einen Vertrag unterschrieben, und mein Mieter bringt mir immer Kuchen. Die Steuern? Naja… ich hab ‘nen kleinen Kassenbuch-Fehler. Aber hey – wer lebt schon perfekt? 😅
Johanna Jensen
November 18, 2025 AT 15:44Die Checkliste ist perfekt. Aber vergesst nicht: Ein guter Mieter ist mehr wert als alle Steuervorteile. Respekt, Kommunikation, Fairness – das zählt.
Sidsel Kvitvik
November 19, 2025 AT 18:00Ich hab meine Tochter in die Einliegerwohnung ziehen lassen – mit 70% Miete. Jetzt bin ich nervös, weil ich gelesen hab, dass es ab 2024 75% sein sollen. Hoffe, das wird rückwirkend nicht angewendet… 🤞
Yorben Meert
November 21, 2025 AT 13:42Ich hab in Belgien eine Einliegerwohnung, und hier ist alles anders. Kein Sonderkündigungsrecht, aber die Mieten sind höher. Und das Beste: Der Mieter hilft mir beim Rasenmähen, und ich koche ihm ab und zu ein Abendessen. Wir haben einen Vertrag, aber der ist nur ein Formular. Der echte Vertrag ist das Vertrauen. Warum macht ihr das so kompliziert? Weil ihr Angst habt, dass jemand euch vertraut. Und das ist das Problem.
isabell nilsson
November 22, 2025 AT 01:29Wer 75% Miete verlangt hat verdient nicht die Steuervorteile. Wer seine eigene Tochter rauswirft für 50 Euro mehr Miete ist kein Vermieter – er ist ein Monster. Und wer das als normal akzeptiert, ist mitverantwortlich für die Zerstörung der Familie in Deutschland