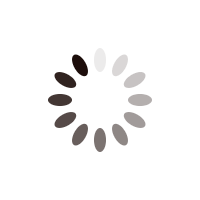Wenn du eine Immobilie verkaufen, kaufen oder finanzieren willst, dann hängt alles von einem einzigen Wert ab: dem Immobilienwert. Aber wie wird der eigentlich berechnet? Viele denken, es sei einfach ein Preis, den ein Makler nennt. Doch das ist falsch. In Deutschland gibt es drei offizielle, gesetzlich festgelegte Verfahren, die jeder Gutachter verwenden muss - und nur diese zählen vor Gericht, bei der Bank oder beim Finanzamt. Das sind das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Kein anderes Verfahren hat rechtliche Gültigkeit. Und jeder von ihnen sagt etwas anderes über deinen Immobilienwert aus.
Das Vergleichswertverfahren: Was andere wirklich bezahlt haben
Dieses Verfahren ist das einfachste - und auch das häufigste. Es fragt: Was haben andere für vergleichbare Wohnungen oder Häuser in der gleichen Straße, im gleichen Viertel oder in der gleichen Stadt bezahlt? Der Gutachter sucht nach mindestens drei tatsächlichen Verkaufstransaktionen aus den letzten zwölf Monaten. Nicht Angebote. Nicht Listings. Verkaufte Immobilien.
Die Merkmale müssen passen: Wohnfläche, Baujahr, Ausstattung, Lage, Anzahl der Zimmer, Balkon oder Terrasse, Parkplatz. Wenn deine Wohnung einen Aufzug hat, aber das Vergleichsobjekt nicht, dann wird ein Aufschlag von etwa 7,2 % angerechnet. Ein Balkon bringt +5,8 %. Ein Tiefgaragenstellplatz +9,3 %. Das sind keine Schätzungen - das sind standardisierte Werte, die von den Gutachterausschüssen in jeder Stadt festgelegt werden.
In Deutschland wird dieses Verfahren in 91 % aller Fälle bei Eigentumswohnungen verwendet. In Frankfurt, München oder Berlin ist es sogar die einzige Methode, die Banken akzeptieren. Warum? Weil es den Markt widerspiegelt. Wenn du in Köln-Ehrenfeld eine Wohnung kaufst und der Vergleichswert bei 4.200 €/m² liegt, dann ist das der Preis, den andere wirklich gezahlt haben. Der Sachwert sagt 3.800 €/m² - zu niedrig. Der Ertragswert sagt 5.100 €/m² - zu hoch. Der Vergleichswert ist realistisch.
Problem? In Ballungsräumen gibt es immer weniger vergleichbare Verkäufe. Die Preise steigen so schnell, dass Transaktionen aus dem letzten Jahr schon veraltet sind. Deshalb arbeiten viele Gutachter heute mit dem Vergleichswert und dem Sachwert zusammen - um den echten Wert zu finden.
Das Ertragswertverfahren: Was die Immobilie verdient
Dieses Verfahren ist kein Preisvergleich - es ist eine Rechnung. Es fragt: Wie viel Geld bringt diese Immobilie jedes Jahr ein? Das ist besonders wichtig für vermietete Häuser, Gewerbeimmobilien oder größere Mehrfamilienhäuser.
Der Reinertrag wird berechnet: Du nimmst die Jahresmiete, ziehst die Verwaltungskosten ab (15-20 % der Miete), Instandhaltung (ca. 1 % des Gebäudeversicherungswerts) und Mietausfall (2-5 %). Was übrig bleibt, ist der Reinertrag. Diesen Wert kapitalisierst du - also teilst du ihn durch einen Zinssatz. Der aktuelle Durchschnitt für Wohnimmobilien liegt bei 3,8-4,2 %. Für Gewerbeimmobilien sind es 4,5-5,2 %.
Ein Beispiel: Ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte mit 10 Wohnungen bringt 180.000 € Jahresmiete. Abzüglich 27.000 € Verwaltung, 9.500 € Instandhaltung und 3.600 € Mietausfall bleibt ein Reinertrag von 139.900 €. Bei einem Zinssatz von 4,1 % ergibt das einen Ertragswert von 3.412.195 €.
Doch hier liegt das Problem: Die Zinssätze stimmen nicht mehr mit den Finanzierungskosten überein. Die EZB hat den Leitzins auf 4,5 % angehoben - aber viele Käufer zahlen 5,5 % oder mehr. Wenn der Gutachter trotzdem mit 4,1 % kapitalisiert, kommt ein Wert heraus, der in der Realität nicht verkauft werden kann. Deshalb ist das Ertragswertverfahren bei derzeitigen Zinsen oft unrealistisch - besonders bei Wohnungen. Bei Gewerbeimmobilien hingegen ist es immer noch das präziseste Verfahren. 12,7 % genauere Ergebnisse als der Vergleichswert, laut einer Studie des IfIW.
Und das ist auch der Grund, warum 78 % der Gutachter bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als fünf Wohnungen das Ertragswertverfahren als primäre Methode wählen. Es misst den wirtschaftlichen Nutzen - nicht den Hype.

Das Sachwertverfahren: Was das Haus kostet, neu zu bauen
Dieses Verfahren ignoriert den Markt. Es ignoriert die Miete. Es fragt nur: Wie viel würde es kosten, dieses Haus heute neu zu bauen?
Der Gutachter multipliziert die Wohnfläche mit den aktuellen Baukosten. Für Standardbauten sind das 2.200-2.800 €/m². Für gehobene Ausstattung 2.800-3.800 €/m². Ein Einfamilienhaus von 140 m² mit gehobener Ausstattung? Dann ist der Wiederbeschaffungswert 448.000 €.
Doch das Haus ist nicht neu. Es ist 40 Jahre alt. Also wird abgezogen: die Alterswertminderung. Die Formel ist einfach: Baujahr + 80 Jahre - aktuelles Jahr = Restnutzungsdauer. 40 Jahre Restnutzungsdauer? Dann ist die Minderung 50 %. Der Sachwert: 224.000 €.
Das klingt nach einem riesigen Abstand zum Marktwert - und das ist es auch. Doch bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern in ländlichen Regionen oder in Alleinlage ist dieses Verfahren oft das genaueste. Warum? Weil es keinen Vergleich gibt. Keine Miete. Keine Verkäufe. Nur das Haus. Und da ist der Sachwert die einzige Orientierung.
Studien zeigen: Bei solchen Häusern ist das Sachwertverfahren mit 9,5 % Genauigkeit präziser als der Vergleichswert (6,2 %). Und in 83 % der Fälle ist es das dominierende Verfahren für Einfamilienhäuser in Alleinlage. Es ist das Verfahren für Häuser, die nicht zum Verkauf stehen - sondern zum Wohnen.
Warum die drei Verfahren nicht übereinstimmen - und was das bedeutet
Du hast jetzt drei Werte: Vergleichswert 4.200 €/m², Ertragswert 5.100 €/m², Sachwert 3.800 €/m². Was ist jetzt der wahre Wert? Die Antwort: Keiner von ihnen allein. Die Abweichungen zwischen den Verfahren können bis zu 35 % betragen - und das ist normal.
Die Deutsche Bundesbank hat festgestellt: In Ballungsräumen wie Berlin oder München liegt der Vergleichswert im Durchschnitt 14,7 % höher als der Ertragswert. In ländlichen Gebieten sind es nur 6,3 %. Das liegt an der Nachfrage. Wo es viele Käufer gibt, steigen die Preise - unabhängig vom Ertrag. Wo es kaum Käufer gibt, zählt nur der Bauwert.
Die BaFin meldet: In den letzten 12 Monaten ist die Abweichung zwischen den Verfahren um durchschnittlich 18,3 % gestiegen. Das ist kein Fehler - das ist ein Signal. Der Markt ist verzerrt. Die Zinsen sind hoch. Die Preise steigen. Die Mieten bleiben oft hinterher. Und die Baukosten sind explodiert.
Das bedeutet: Wenn du dich nur auf ein Verfahren verlässt, irrst du dich. Du musst alle drei betrachten. Und dann entscheiden: Was ist für dich relevant?

Wie du das richtige Verfahren für deine Immobilie wählst
Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Aber es gibt klare Muster - und die sind wichtig, wenn du eine Immobilie bewerten lässt oder einen Kauf tätigst.
- Eigentumswohnung in der Stadt? Vergleichswert ist König. 91 % der Gutachter nutzen ihn. Der Ertragswert ist oft unrealistisch hoch, der Sachwert zu niedrig. Kombiniere ihn mit dem Sachwert - und akzeptiere nur Werte, die innerhalb von ±10 % übereinstimmen.
- Mehrfamilienhaus mit Miete? Ertragswert ist die Basis. Aber du musst ihn mit dem Vergleichswert abgleichen. Wenn der Vergleichswert 20 % höher ist, dann ist der Markt überhitzt. Du solltest nicht mehr zahlen, als der Ertragswert hergibt - sonst verlierst du Geld.
- Einfamilienhaus in ländlicher Gegend? Sachwert ist dein Anker. Wenn du kein Mieteinnahmen hast und keine vergleichbaren Verkäufe findest, dann ist der Wiederbeschaffungswert dein einziger Bezugspunkt. Kombiniere ihn mit dem Vergleichswert - und akzeptiere nur Abweichungen von maximal ±12 %.
Die Deutsche Grundstücks- und Wohnungswirtschaftliche Gesellschaft (DGW) empfiehlt genau diese Kombinationen. Und der Deutsche Gutachterverband (DGVM) sagt: 65 % der Gutachter nutzen heute alle drei Verfahren bei komplexen Fällen. Das ist der neue Standard.
Was kommt als Nächstes? Die Zukunft der Immobilienbewertung
Die ImmoWertV - die Immobilienwertermittlungsverordnung - wird 2025 wahrscheinlich geändert. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat bereits angekündigt: Es wird eine gesetzliche Verpflichtung geben, bei bestimmten Immobilientypen alle drei Verfahren zu kombinieren.
Warum? Weil die Märkte nicht mehr linear funktionieren. Die Zinsen sind hoch, die Preise ungleich, die Nachfrage ungleichmäßig. Ein einzelnes Verfahren reicht nicht mehr aus. Du brauchst ein Gesamtbild.
Die Zukunft der Immobilienbewertung ist nicht mehr ein Wert. Sie ist ein Bereich. Ein Bereich, der aus drei Säulen besteht: Markt, Ertrag, Substanz. Und du musst lernen, alle drei zu lesen.
Wenn du eine Immobilie kaufst: Frag nicht, was sie wert ist. Frag: Was sagt der Vergleichswert? Was sagt der Ertragswert? Was sagt der Sachwert? Und warum unterscheiden sie sich? Dann weißt du, ob du einen fairen Preis zahlst - oder in eine Falle tappst.
Welches Verfahren ist am vertrauenswürdigsten?
Es hängt vom Immobilientyp ab. Bei Eigentumswohnungen ist das Vergleichswertverfahren am vertrauenswürdigsten - 68 % der Käufer vertrauen ihm am meisten. Bei vermieteten Mehrfamilienhäusern ist das Ertragswertverfahren präziser. Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern in ländlichen Regionen ist das Sachwertverfahren die zuverlässigste Methode. Keines ist generell besser - sie messen verschiedene Dinge.
Warum ist der Ertragswert oft höher als der Vergleichswert?
Weil der Ertragswert die Miete kapitalisiert - aber nicht den Markt berücksichtigt. Wenn die Nachfrage hoch ist und die Zinsen niedrig, steigen die Preise schneller als die Mieten. Dann kommt ein hoher Ertragswert heraus, der nicht verkauft werden kann. In Ballungsräumen ist das heute häufig der Fall. Der Vergleichswert zeigt, was Käufer wirklich zahlen - nicht was die Rechnung vorschlägt.
Kann ich den Sachwert als Kaufpreis nutzen?
Nur wenn es keine vergleichbaren Verkäufe gibt und keine Mieteinnahmen. Bei einem Einfamilienhaus in einer abgelegenen Gegend mit wenig Nachfrage ist der Sachwert ein guter Orientierungspunkt. Aber in der Stadt oder bei vermieteten Objekten ist er meist zu niedrig. Du würdest viel zu wenig bieten - und verlierst die Chance.
Warum wird das Vergleichswertverfahren bei kleinen Wohnungen häufiger überschätzt?
Weil kleine Wohnungen (unter 80 m²) besonders begehrt sind - besonders in Städten. Die Nachfrage ist hoch, das Angebot gering. Deshalb zahlen Käufer oft mehr pro Quadratmeter als bei größeren Wohnungen. Der Vergleichswert spiegelt das wider - und ist deshalb oft höher als der Ertragswert. Bei Wohnungen über 120 m² ist die Abweichung kleiner, weil sie weniger spekulativ gehandelt werden.
Was tun, wenn die drei Werte sehr unterschiedlich sind?
Dann ist der Markt instabil - und du solltest vorsichtig sein. Prüfe, ob die Daten stimmen: Sind die Vergleichsobjekte wirklich vergleichbar? Ist der Ertragswert mit aktuellen Zinsen berechnet? Ist die Alterswertminderung korrekt? Wenn alles stimmt, dann ist der Mittelwert oder der Wert, der am meisten mit der Realität übereinstimmt, der beste Anhaltspunkt. Ein Gutachter sollte dir erklären, warum die Werte auseinanderlaufen - und welcher für dich relevant ist.